Gedanken zur Implementierung von Unternehmenssoftware und zu Projektmanagementmethoden.
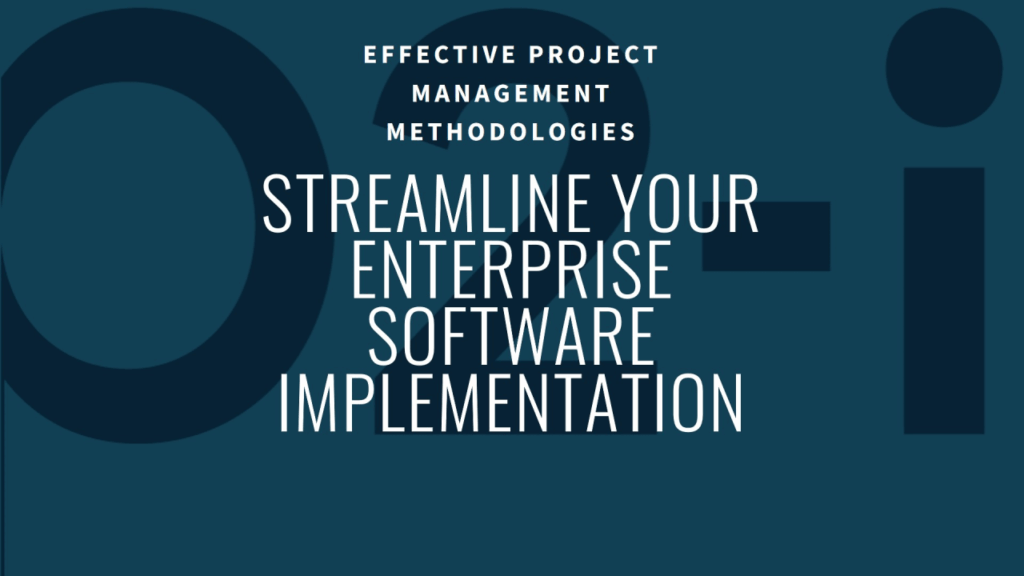
Jedes Projekt zur Steuerung einer ERP-Implementierung ist, unabhängig von der verwendeten Methodik oder der Bezeichnung der Phasen, typischerweise nach dem gleichen Muster strukturiert.
- Projektinitiierung
- Planung
- Design
- Entwicklung
- Testen
- Schulung und Veränderungsmanagement
- Go-Live-Vorbereitung
- Go-Live
- Unterstützung nach der Inbetriebnahme
- Projektabschluss
Und so ist es seit mindestens den letzten 30 Jahren. Als Unternehmen begannen, „Agile“ für Projekte einzusetzen (und ich weiß, dass ich hier eine Vereinfachung nehme), änderte sich die Vorgehensweise nicht wirklich; es bedeutete oft nur, dass die (detaillierte Planung und) Entwicklung und das Testen zu iterativen Zyklen wurden.
- Initiierung und Planung
- Entdeckung und Design
- Iterative Entwicklung und Test
- Anwenderschulung und Änderungsmanagement
- Go-Live-Vorbereitung
- Go-Live und Stabilisierung
- Kontinuierliche Verbesserung
Als das Konzept der „kontinuierlichen Verbesserung“ eingeführt wurde, hatten nur wenige Organisationen eine Vorstellung davon, wie dieses Konzept in ihre Organisationen integriert werden könnte, insbesondere wenn das Implementierungsprojektteam aufgelöst wird.
Die in der Einleitung beschriebene Struktur zur Organisation eines ERP-Projekts basiert auf dem Verständnis, dass eine Softwareplattform eine Organisation unterstützt (oder unterstützen sollte): die strategischen Ziele und Vorgaben der Organisation, die Organisationsstruktur, ihre geografische Präsenz, ihre Abteilungen, die Geschäftsprozesse, die KPIs und alle Anforderungen der Mitarbeiter an effizientes und effektives Arbeiten. Das Projekt beginnt daher mit der Analyse des Unternehmens, seiner aktuellen Abläufe, seiner Organisation und seiner (strategischen) Anforderungen und Ziele. Diese Analyse konzentriert sich auf Geschäftsanforderungen, Prozessanforderungen sowie die Geschäftsziele. Die IT-Anforderungen werden in geringerem Maße analysiert: Sie werden (sollten) von den Geschäftszielen und -anforderungen bestimmt. Ausnahmen bilden Migrations- und Anwendungsintegrationsanforderungen; hier ergeben sich die Anforderungen aus der Technologie selbst.
Kurz gesagt, die Methodik von ERP-Projekten besteht darin, die Anforderungen zu analysieren und die geplante Organisation, die (geänderten und neuen) Prozesse und Anwendungen zu entwerfen. Anschließend wird die Anwendungsplattform auf Basis des Entwurfs erstellt und die neuen Prozesse und Tools werden geschult und validiert. Der letzte Schritt ist die Inbetriebnahme (Go-Live) und die Unterstützung der Organisation sowie die Behebung aller Probleme, die in den ersten Tagen, Wochen oder Monaten nach dem Go-Live auftreten.
Die Frage ist, wie erfolgreich und effektiv die auf den oben genannten Prinzipien basierenden Implementierungsmethoden tatsächlich sind. Viele ERP-Projekte scheitern heutzutage oder gelten zumindest als weniger erfolgreich. Ein Projekt gilt heutzutage als erfolgreich, wenn es mindestens den gleichen Funktionsumfang wie das alte (ersetzte) System bietet und die Technologie auf den heutigen Stand gebracht wurde.
Und das ist merkwürdig, wenn das Projekt als Erfolg gilt, obwohl der einzige Vorteil die neue Technologie ist und die Organisation in Bezug auf Kultur, Prozesse und Zielerreichung kaum oder gar nichts gewonnen hat. Die Frage ist: Warum halten wir trotzdem an der Methodik fest?
Die Herausforderungen heutiger ERP-Implementierungen lassen sich am besten wie folgt zusammenfassen:
- Die Organisation ist von den Ergebnissen enttäuscht.
- Das Projekt dauert länger als erwartet
- Das Projekt kostet mehr als veranschlagt.
- Es herrscht Frustration zwischen dem Implementierungspartner und dem Kunden.
Wenn wir versuchen, diese Frustrationen der Organisation des Implementierungsprojekts oder der verwendeten Methodik zuzuordnen, können wir sagen, dass die folgenden Bereiche die Hauptgründe für sogenannte ERP-Implementierungsfehler sind:
- Projektmanagement und Governance: Ausweitung des Projektumfangs, Probleme bei der Ressourcenzuweisung und -verfügbarkeit sowie natürlich die Unfähigkeit des Projektmanagers, das Projekt zu organisieren, weil es an Unterstützung mangelt oder weil die Methodik im Unternehmen nicht implementiert ist und das Unternehmen/die Führungsebene die Methodik nicht versteht.
- Veränderungsmanagement und Anwenderschulung: Mitarbeiter sträuben sich gegen Veränderungen aufgrund von Unkenntnis, Angst vor Arbeitsplatzverlust oder mangelnder Schulung und Kommunikation. Der Umfang und die Tiefe der erforderlichen Schulungen, damit Anwender das Projekt effektiv verstehen, werden oft unterschätzt. Im späteren Projektverlauf sind Schulungen zur Nutzung des neuen Systems und der neuen Prozesse dann natürlich unzureichend und ineffizient.
- Kulturelle und organisatorische Auswirkungen: Fehlende gemeinsame Ziele und Visionen der Abteilungen und Stakeholder sind ein häufiges Problem vieler Projekte. Zudem ist das Projekt oft nicht auf die strategischen Ziele des Unternehmens abgestimmt, und die Geschäftsleitung erkennt dessen Bedeutung in diesem Bereich nicht an (was zu einem erheblichen Mangel an Unterstützung führt). Dies ist ein wesentlicher Faktor für Misserfolg und Frustration. Auch beim Change-Management wird der notwendige Kulturwandel zur Anpassung an neue Prozesse und Tools unterschätzt oder gar ignoriert, was wiederum Enttäuschung und Frustration hervorruft. Zwei weitere wichtige Punkte sind Kommunikation und Flexibilität. Das Management erkennt den Druck des Projekts (die Veränderung) auf die Organisation oft erst zu spät und gerät in Panik. Dadurch sinkt die Bereitschaft zu Flexibilität, Kreativität und Anpassungsfähigkeit. Wir beobachten außerdem, dass die Kommunikation innerhalb der Organisation mit zunehmender Komplexität abnimmt und schließlich ganz vernachlässigt wird.
- Prozessreengineering: Wie bereits erwähnt, ist das gründliche Verständnis und die Dokumentation bestehender Prozesse vor der Entwicklung neuer Prozesse oder der Umstellung auf ein neues ERP-System deutlich komplexer und zeitaufwändiger als erwartet oder von Unternehmen bereit zu tragen (und zu investieren). Die Angleichung der gewünschten Geschäftsprozesse an die Standardprozesse des ERP-Systems ohne umfangreiche Anpassungen kann eine Herausforderung darstellen und das Projektteam frustrieren oder demotivieren.
Sind das die einzigen Gründe für Frustration und Projektprobleme? Es fällt auf, dass die Datenmigration häufig als Herausforderung genannt wird. Obwohl sie in manchen Projekten zu Verzögerungen und Mehrkosten führt, ist sie fast nie der Grund für Enttäuschung oder Unzufriedenheit mit dem Projektnutzen (dem erzielten Wert). Auch Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Anpassungen und Integrationen können – oder werden es fast immer – zu zusätzlichem Zeit- und Kostenaufwand führen. Doch das ist nie der Grund dafür, dass nach dem Go-Live das Gefühl entsteht, nicht alles Gewünschte oder Erforderliche sei erfüllt worden. Ich würde sogar behaupten, dass das Gegenteil der Fall ist: Die Softwareauslieferung ist das Einzige, was wirklich gemessen und kontrolliert wird. Anwendungsfunktionalität, Migration, Anpassungen, Integrationen, Berichte usw. sind im Grunde die „einfachen Dinge“, die sich managen lassen.
Wenn bei Projektbewertungen Testphasen oder die Unterstützung nach der Implementierung als Herausforderungen aufgezeigt werden, würde ich sagen, dass dies eher auf ein schlechtes Projektmanagement und/oder die Motivation der Organisation zurückzuführen ist, die richtige Anzahl an Mitarbeitern einzusetzen und die Bedeutung und die Auswirkungen des Projekts, wie bereits erwähnt, anzuerkennen.
Ich glaube, die oben genannten Gründe sind die Ursache für das Scheitern des Projekts und erfordern, dass wir die von uns angewandte Methodik überdenken und uns Gedanken über die Ressourcen und Fähigkeiten machen, die wir für die erfolgreiche Durchführung und das Management eines ERP-Projekts benötigen.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass eine agile oder alternative Projektumsetzungsmethodik aufgrund von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Benutzereinbindung, Risikominderung und verbesserter Kommunikation eher zum Erfolg führt als der Wasserfallansatz.
Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass ich davon überzeugt bin, dass nach einem anfänglich schwierigen Projekt zur Implementierung eines ERP-Systems kontinuierliche Verbesserungsprojekte deutlich bessere Erfolgsaussichten und Unternehmen wesentlich mehr Nutzen daraus ziehen – natürlich nur, wenn sie solche Projekte weiterhin zulassen und die Bereitschaft zur Veränderung zu einem zentralen Wert ihrer Unternehmenskultur machen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Cloud-Systeme das beste Werkzeug für kontinuierliche Verbesserung darstellen.
Ich möchte dieses Papier als Diskussionspapier und als Beginn einer Diskussion innerhalb von p2-i sowie mit Partnern und Kunden verstehen, um uns dabei zu helfen, unsere eigene Organisation und unsere Dienstleistungen zu verbessern:
- Die richtige Methodik festlegen
- Lassen Sie unsere PM-Funktion organisieren
- Wir stellen die Mitarbeiter ein, die wir für die Umsetzung der Methodik benötigen.
- Unsere Mitarbeiter werden geschult und kontinuierlich weitergebildet, um in unserer Methodik erfolgreich zu sein.
- Schulen und organisieren Sie das Vertriebsteam, damit es unsere Projekte verkaufen kann.
- Projekte erfolgreich durchführen
Ich freue mich über eure Kommentare und Meinungen!
Verfasst von Amit Kumar
9. Dezember 2024